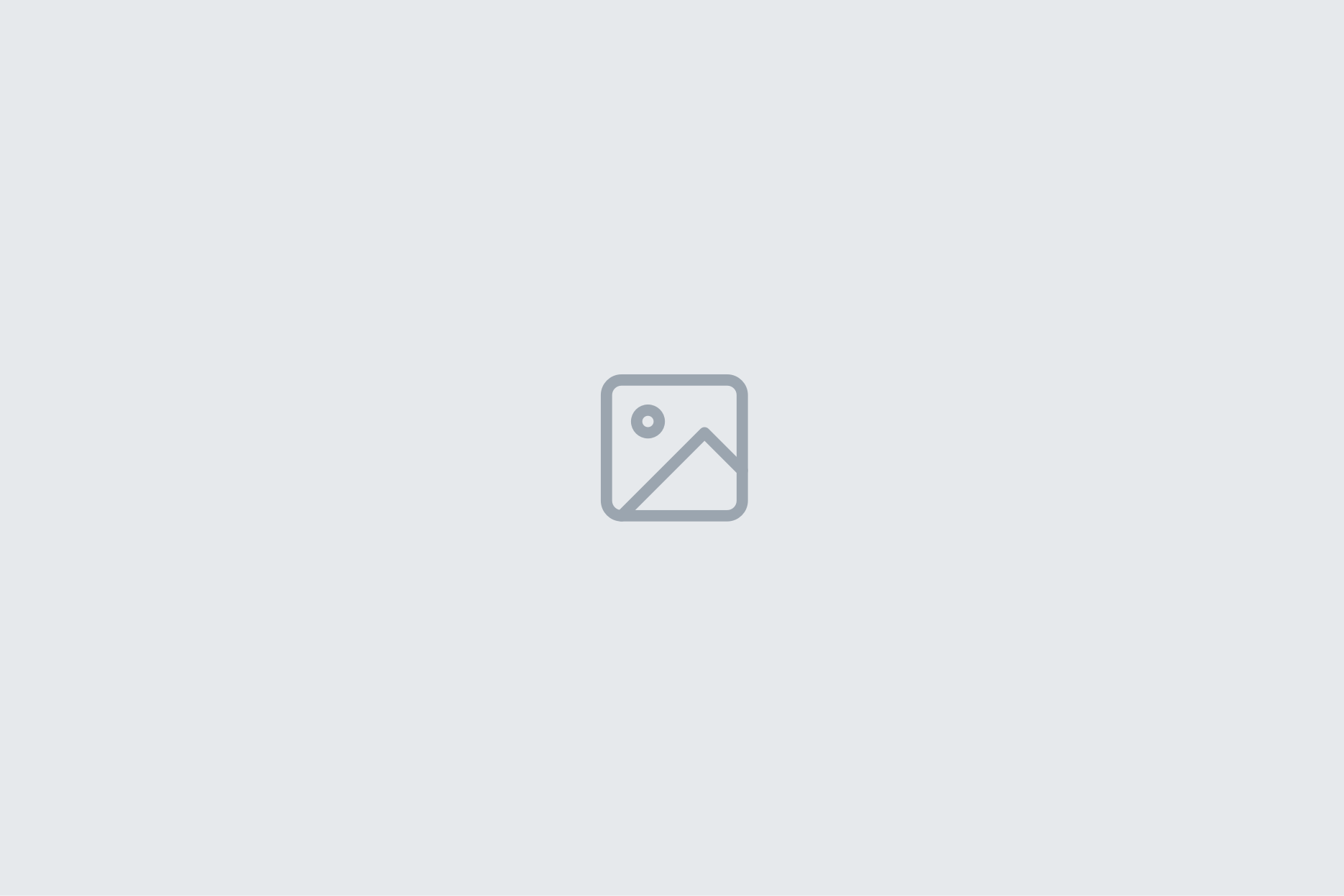Die Schönheit des Glaubens – kann das wirklich der Anfang sein? Fulbert Steffensky behauptet genau das: „Man kann auf Dauer nur an etwas glauben, das man schön gefunden hat.“ Diese radikale These fordert heraus, gerade in der Klinikseelsorge, wo ich täglich mit Leid und Sterben konfrontiert bin. Und doch – oder gerade deshalb – bleibt sie unverzichtbar.
„Man kann auf Dauer nur an etwas glauben, das man schön gefunden hat.“
Als ich diesen Satz des evangelischen Theologen Fulbert Steffensky zum ersten Mal las, hat er mich getroffen. Nicht, weil er leicht daherkommt – sondern weil er wahr ist. Weil ich selbst immer wieder erlebe, dass Menschen nicht durch Argumente zum Glauben finden, sondern durch Momente, in denen sie aufatmen.
Steffensky hat diesen Satz in einem Interview mit Angela Berlis formuliert und in ähnlicher Form mehrfach aufgenommen. Nicht Wahrheit, nicht Moral, nicht Nützlichkeit stehen am Anfang des Glaubens, sondern Schönheit. Eine Faszination. Ein Aufatmen.
Was auf den ersten Blick wie eine Sentimentalisierung des Glaubens klingt, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als theologisch tiefgründig – und zugleich als streitbar. Denn lässt sich das halten?
Was Steffensky meint
Für Steffensky ist christlicher Glaube „zwecklos schön“ – nicht primär nützlich, nicht funktional, sondern faszinierend. In Geschichten, Bildern, Liedern, liturgischen Gesten zeigt sich eine Hoffnung, die Menschen anzieht, bevor sie verstanden wird.
Schönheit meint bei ihm nicht Oberflächenästhetik. Es geht ihm um die erfahrbare Gestalt von Hoffnung und Trost – um eine Weise, wie Zartheit sich zeigt, wie Widerstand gegen Unrecht Form annimmt, wie Menschen sich nicht von der Hoffnung losmachen, selbst wenn die Welt dagegen spricht.
Diese Schönheit überzeugt nicht durch Argumente – sie überzeugt, indem sie berührt. Und erst diese Berührung öffnet den Raum, in dem Wahrheit verständlich wird. Schönheit ist kein Ersatz für Wahrheit, sondern der Weg zu ihr.
Steffensky wendet sich gegen einen Glauben, der zwar recht haben will, aber niemanden anzieht. Gegen eine Theologie, die mehr an Dogmen interessiert ist als daran, ob Menschen darin aufatmen können. Sein Satz ist ein Widerspruch gegen jeden Glauben ohne Charme.
Der Einwand – und warum er ernst zu nehmen ist
Und doch – der Satz provoziert Widerspruch. Zu Recht.
Kann Glaube wirklich davon abhängen, ob mir Gott „schön“ vorkommt? Das Kreuz ist nicht ästhetisch anziehend. Das Gericht Gottes ist keine Faszination. Gott offenbart sich – auch wenn diese Offenbarung zunächst unschön erscheint.
Und was ist mit den Menschen, denen nichts mehr schön vorkommt? Die in der Depression keine Farben mehr sehen. Die erschöpft sind bis zur Leere. Ist Steffenskys Satz für sie überhaupt zugänglich – oder ist er ein Luxus für die, denen es noch gut genug geht?
Noch radikaler: Was ist mit dem Schrecken von Krieg und Gewalt? Von Leid und Krankheit? Überblendet eine Ästhetik des Glaubens nicht das Grauen der Welt? Steffensky selbst hat immer betont, dass der Glaube an Gott und das Brot der Armen zusammengehören – aber sein Satz lädt zu Missverständnissen ein, wenn man die politische und soziale Schärfe ausblendet.
Schönheit kann verführen. Sie kann blenden. Sie kann ideologisch werden. Sie kann das Leiden verkitschen, statt es ernst zu nehmen.
Das sind keine akademischen Einwände. Das sind existenzielle Fragen.
Die Schönheit des Kreuzes – oder: Warum der Satz gerade dort gilt, wo es dunkel ist
Aber vielleicht liegt genau hier das Missverständnis. Vielleicht geht es nicht darum, das Kreuz schön zu reden. Sondern darum zu sehen, dass das Kreuz eine andere Schönheit hat – die Schönheit des Durchhaltens. Des Nicht-Aufgebens. Des Trotzdem.
Das Kreuz ist nicht schön als Bild. Aber es ist schön als Hoffnung. Als Zeichen dafür, dass Gott sich nicht abwendet. Dass er bleibt. Dass er mit hinabsteigt ins Dunkel.
Dietrich Bonhoeffer hat das in seinem Lied „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ zum Klingen gebracht. Geschrieben in der Todeszelle, angesichts des eigenen Endes. Kein naiver Optimismus. Keine Verklärung. Aber eine Hoffnung, die sich nicht brechen lässt. Und genau diese Hoffnung – die trotzdem bleibt – hat ihre eigene Schönheit.
Die Klagepsalmen sind nicht schön als Literatur des Schreckens. Aber sie sind schön, weil sie dem Schrei Raum geben. Weil sie das Leiden nicht beschönigen, sondern vor Gott bringen. Weil sie zeigen: Hier darf alles gesagt werden.
Schönheit im Angesicht des Leidens ist nicht Flucht. Sie ist Widerstand. Widerstand gegen die Verzweiflung. Gegen die Resignation. Gegen die Hoffnungslosigkeit.
Und gerade dort, wo Menschen am Ende sind, zeigt sich: Steffenskys Satz bleibt unverzichtbar. Nicht als Antwort auf das Leiden. Sondern als Widerstand dagegen, dass das Leiden das letzte Wort behält.
Was das für die Praxis bedeutet
Wenn Schönheit der Weg ist, auf dem Hoffnung erfahrbar wird, dann muss Seelsorge Räume eröffnen, in denen solche Erfahrungen möglich werden.
In der Klinikseelsorge
Wenn ich in der psychiatrischen Klinik bei einer Patientin sitze, die seit Wochen nicht schlafen kann, dann helfen keine theologischen Erklärungen. Keine Argumente für Gottes Existenz. Aber manchmal hilft ein Lied. Ein Psalmvers. Eine Kerze, die brennt.Wie ich selbst zum Glauben gefunden habe, beschreibe ich ausführlicher in meinem Glaubensprofil.
Ich erinnere mich an eine Frau, die mir sagte: „Ich kann nicht mehr beten. Ich habe keine Worte mehr.“ Wir saßen schweigend zusammen. Dann schlug ich vor, gemeinsam Psalm 23 zu lesen. Als wir bei „Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal“ ankamen, sagte sie: „Genau das ist es.“
Seelsorge muss nicht primär erklären. Sie kann Raum schaffen für Momente des Aufatmens. Für kleine Unterbrechungen der Schwere.
Im Gottesdienst
In den Klinikgottesdiensten erlebe ich: Menschen kommen nicht, weil sie theologisch überzeugt werden wollen. Sie kommen, weil sie spüren – hier ist etwas, das trägt.
Besonders beim Abendmahl wird das deutlich. Wenn ich sage: „Christus spricht: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid“ – dann ist das keine Lehre. Das ist eine Einladung.
Die Frage ist: Wird der Gottesdienst zu einem Ort, an dem Menschen aufatmen können? Oder wird er zu einem Pflichtprogramm, das zwar „richtig“ ist, aber niemanden berührt?Was das für eine Kirche der Zukunft bedeutet, habe ich hier weitergedacht.
Das bedeutet konkret: Die Lieder müssen stimmen – nicht nur textlich, sondern musikalisch. Die Worte müssen tragen, nicht belehren. Die Liturgie muss Raum schaffen.
Beim Singen
Beim Singen zeigt sich Steffenskys These am unmittelbarsten. Lieder wirken nicht, weil sie theologisch korrekt sind. Sie wirken, weil sie schön sind. Weil sie etwas in Menschen zum Klingen bringen.
Wenn wir in der Klink bei Offenen Singen „Der Mond ist aufgegangen“ anstimmen, dann passiert etwas. Menschen, die vorher starr dasaßen, werden ruhiger. Manchmal singen sie mit, manchmal nicht.
„Von guten Mächten wunderbar geborgen“ – dieses Lied ist keine systematische Hoffnungslehre. Aber es trägt. Menschen singen es, die Bonhoeffers Theologie nicht kennen. Die vielleicht nicht einmal glauben. Aber sie spüren: Hier ist etwas, das Kraft gibt.
Ein Lied, das Menschen zum Atmen bringt, ist ein Geschenk.
Warum der Satz unverzichtbar bleibt
Steffenskys Satz erinnert daran, dass Glaube nicht mit dem Kopf beginnt. Dass Menschen nicht durch Dogmen überzeugt werden, sondern berührt. Dass ein Lied mehr Theologie transportieren kann als ein Lehrsatz.
Das ist ein Korrektiv. Gegen einen Glauben, der nur noch argumentiert. Der belehrt. Der moralisiert.
Die Erfahrung von Schönheit ist keine Beliebigkeit. Sie ist eine Einsicht: Man kann auf Dauer nur leben von dem, was Hoffnung schenkt. Was anzieht. Was trägt.
Natürlich muss diese Schönheit kritisch bleiben. Sie darf nicht zum Kitsch werden, nicht zur Ideologie, nicht zur Verklärung des Leids. Aber sie darf auch nicht fehlen. Denn ein Glaube ohne Schönheit ist leblos. Er hat vielleicht Recht – aber er zieht niemanden an.
Am Ende
Wenn in der Psychiatrie ein Lied erklingt. Wenn im Gottesdienst eine Kerze brennt. Wenn ein Psalmvers aufleuchtet. Dann ist das kein naiver Eskapismus. Das ist ein Zeichen: Die Schwere hat nicht das letzte Wort.
Steffenskys Satz ist keine Sentimentalität. Er ist existenzielle Wahrheit. Glaube lebt nicht aus Pflicht, sondern aus Faszination.
Meine Aufgabe ist es, Räume zu schaffen, in denen Menschen spüren können: Hier ist etwas Schönes. Hier ist Hoffnung. Hier darf ich sein.
Nicht als Flucht vor der Realität. Sondern als Widerstand dagegen, dass die Realität das letzte Wort behält.
Quellen und Literatur
Viele Texte sind online verfügbar und lesenswert (Stand 9.1.2026).
Primärliteratur Fulbert Steffensky
- Fulbert Steffensky / Angela Berlis: „Man kann auf Dauer nur an etwas glauben, das man schön gefunden hat.“ Interview, in: Christkatholisch 140 (2017), Nr. 17, 4–7. PDF ↗
- Fulbert Steffensky: „Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte – Über die Schönheit des Protestantismus“, EKD, 26.09.2009. EKD ↗
- Fulbert Steffensky: „Die Schönheit des dickköpfigen Stolzes“, Imprimatur, 2010. Imprimatur ↗
- Fulbert Steffensky: Schwarzbrot‑Spiritualität. Warum weniger mehr ist. Stuttgart: Kreuz, 2006.
- Fulbert Steffensky: Gott und das Brot der Armen. Zusammenfassung: Paul M. Zulehner – Blog ↗
Sekundärliteratur
- Daniel Hoffmann: „Die zwecklose Schönheit des Glaubens. Ein Blick auf widerspenstige Gedanken Fulbert Steffenskys anlässlich seines 90. Geburtstages“, in: Deutsches Pfarrerblatt 123,6 (2023), 357–361. Deutsches Pfarrerblatt ↗
- Werner Löser SJ: „Der herrliche Gott und die Augen des Glaubens“. Sankt Georgen – PDF ↗
- Ralf Ehret: „Schönheit. Zum Verhältnis von Kunst und Theologie“. Sophia University – PDF ↗
Matthias ist Krankenhausseelsorger und denkt nach über Gott und die Welt – unter weitem Himmel.