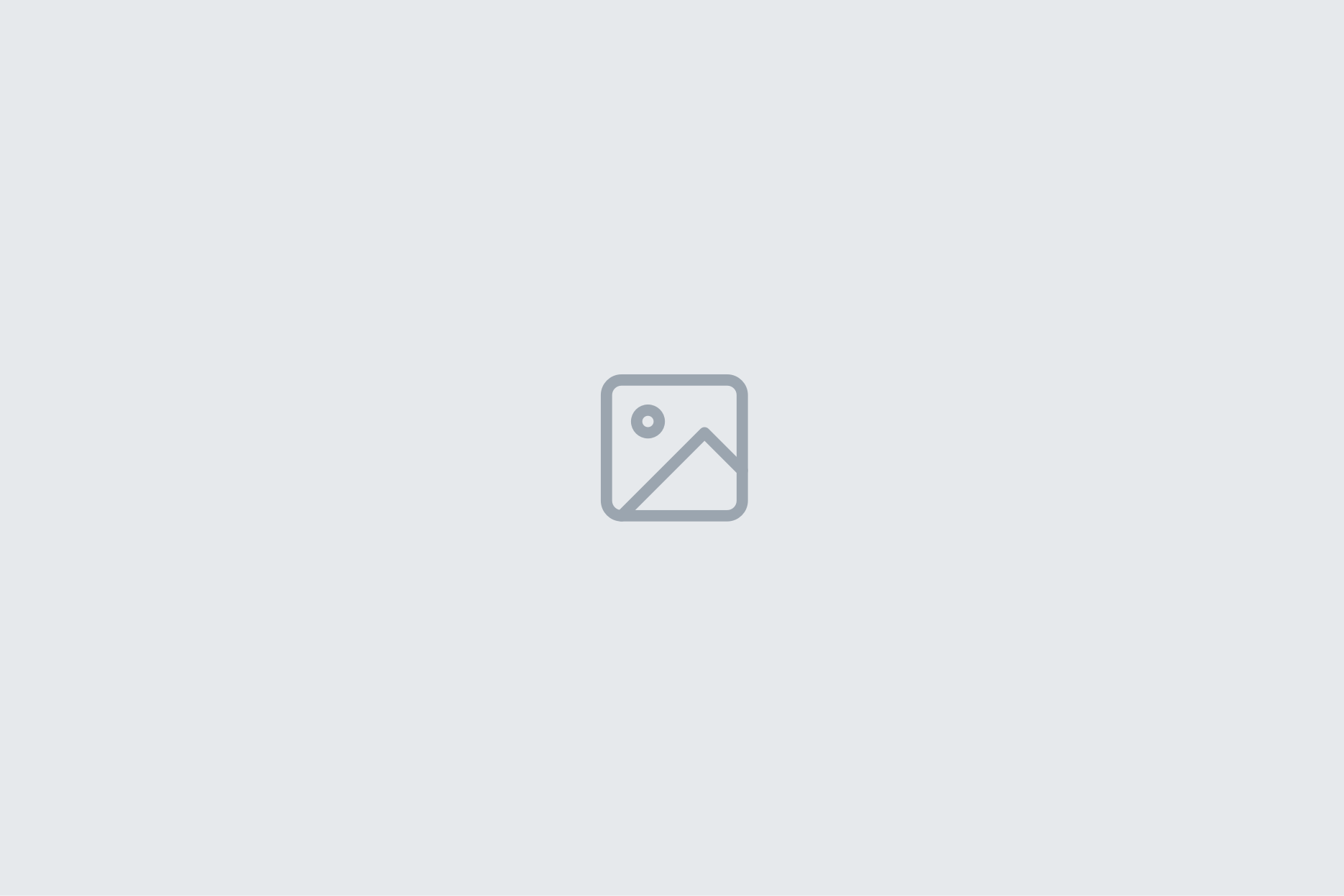Singen, wo Worte nicht reichen
Dreißig Menschen. Dreißig Stimmen. Dreißig Geschichten vom Leben. Und dann: Gesang. Nicht perfekt. Nicht professionell. Aber echt.
Ich baue die Gitarre auf, lege Liedbücher aus. Nach und nach kommen sie: Patientinnen und Patienten, manche neugierig, manche skeptisch, manche einfach nur, weil sie nicht allein auf ihrem Zimmer sein wollen.
„Was singen wir denn heute?“, fragt jemand. „Was mögen Sie?“, frage ich zurück. „Über sieben Brücken!“ – „Der Mond ist aufgegangen!“ – „Let it be!“ Ich nicke. „Gut. Dann fangen wir damit an.“
Wenn der Mund weiter ist als das Herz
Oft sitzen Menschen im Kreis, die gerade alles andere sind als stark. Die Seele müde, der Körper erschöpft, die Gedanken voll Sorge. Und doch: Sie singen.
Fulbert Steffensky beschreibt, dass unser Mund manchmal weiter ist als unser Herz – die Lieder ziehen das müde Herz hinter sich her, bis es wieder stehen kann. Dieser Gedanke trifft genau das, was ich in der Klinik erlebe.
Wir singen nicht, weil wir schon Hoffnung haben. Wir singen, weil wir nach Hoffnung suchen. Manchmal singt zuerst nur der Mund; das Herz kommt später nach.
In solchen Momenten spüre ich: Der Körper weiß etwas, das der Kopf vergessen hat. Die Stimme erinnert sich an etwas, das die Seele verloren glaubt.
Mehr als fromme Texte
Am Mittwochabend singen wir nicht nur Choräle wie „Der Mond ist aufgegangen“ oder „Von guten Mächten“. Wir singen auch „Über sieben Brücken“, „Let it be“ oder „Über den Wolken“. Lieder, die auf den ersten Blick nichts „Religiöses“ haben – und doch berühren sie etwas Heiliges.
Musik ist für viele Menschen eine Muttersprache des Lebens – manchmal die einzige Sprache, die bleibt, wenn Worte versagen. Steffensky spricht davon, dass Lieder und Musik eine „Muttersprache des Dankes“ seien, weil Dank nicht argumentiert, sondern tanzt. Das leuchtet mir ein: Dank lässt sich nicht herleiten, er bricht hervor.
Genau das erlebe ich in der Klinik: Wir singen nicht, weil alles gut ist. Wir singen, um einen Moment lang zu spüren, dass da noch mehr ist als Diagnose, Symptom und Aktenlage. Manchmal ist ein Lied der einzige Satz, den jemand an diesem Tag „sagt“.
Schönheit, die Raum öffnet
Es gibt Abende, da wirkt der Raum schwer, bevor wir beginnen. Müdigkeit, Anspannung, unausgesprochene Angst stehen im Raum. Dann stimmen wir ein Lied an. Nicht immer geschieht etwas Sichtbares – aber manchmal verändert sich die Atmosphäre spürbar.
Eine Frau mit schwerer Depression sitzt oft mit im Kreis. Wochenlang spricht sie kaum. Eines Abends, bei „Let it be“, bewegt sich ihr Mund. Sie summt mit, ganz leise. Nach dem Singen bleibt sie sitzen. „Das war schön“, sagt sie. „Danke.“ Der Schmerz ist nicht weg. Aber es hat sich ein Spalt geöffnet. Und manchmal ist genau das genug: ein Spalt. Ein Atemzug. Ein Moment, in dem die Schwere einen Millimeter leichter wird.
Schönheit heilt nicht wie ein Medikament. Sie folgt keinen Leitlinien. Sie ist „nutzlos“ im Sinne von nicht messbar – und gerade darin kostbar.
Die Gemeinschaft der Singenden
Wenn wir „Der Mond ist aufgegangen“ singen, sind wir nicht allein. Wir stehen in einer langen Reihe von Menschen, die dieses Lied am Bett ihrer Kinder, am Krankenbett, am Grab gesungen haben.
Wer singt, steht nicht bei null, sondern steigt in einen größeren Klangraum ein. Das gilt auch für „Über sieben Brücken“ oder „Let it be“. Diese Lieder tragen die Erfahrungen vieler Menschen in sich – Aufbruch, Trennung, Trost, Loslassen. Wenn wir sie in der Klinik singen, leihen wir uns für einen Moment etwas von dieser größeren Geschichte.
Ich erlebe: Niemand muss nur seine eigene Glaubenskraft mitbringen. Manchmal trägt der Gesang der anderen – die Stimmen im Raum, die Stimmen derer, die vor uns gesungen haben, und vielleicht auch die Stimmen derer, an die wir uns im Stillen halten.
Singen jenseits der Worte
Es gibt Situationen, in denen Worte nicht mehr helfen. Wo jede Erklärung hohl klingt. Wo fromme Sätze eher verletzen als trösten.
In solchen Momenten bleibt manchmal nur noch das Singen. Nicht als Flucht aus der Realität, sondern als Zugang in eine tiefere Schicht dieser Realität. Dort, wo Trauer, Hoffnung, Vertrauen und Sehnsucht sich nicht mehr sortieren lassen, aber trotzdem da sind.
Steffensky formuliert es so, dass wir uns im Singen manchmal selbst voraus sind – weiter als unsere Einsichten und Argumente, weiter als unser Zweifel. Beim Singen tun Menschen so, als könnten sie schon glauben oder hoffen – und manchmal wächst aus diesem „Als ob“ ein echter, kleiner Funke Vertrauen.
Ich kann meinen Patientinnen und Patienten nicht beweisen, dass das Leben sich lohnt. Ich kann ihnen nicht garantieren, dass alles gut wird. Aber ich kann mit ihnen singen. Und manchmal – nicht immer, aber manchmal – reicht das für diesen Abend.
Die nutzlose Schönheit bewahren
Am Ende des Offenen Singens packe ich die Gitarre ein. Ein Mann bleibt stehen. „Können wir das jede Woche machen?“ – „Ja“, sage ich. „Jeden Mittwoch.“ – „Gut. Das brauche ich.“
Ein anderer Patient ergänzt: „Als ich letzte Woche nach dem Singen zu meinem Zimmer ging begegnete ich einer Pflegerin. Sie sagte zu mir: „Sie strahlen ja so.““
Das Offene Singen hat keinen therapeutischen Auftrag auf Rezept, keine festgelegten Ziele, keine Erfolgskriterien. Es bringt nichts im ökonomischen Sinn, es verbessert keine Kennzahlen. Es ist einfach da. Raum für Schönheit. Raum für Gemeinschaft. Raum für das, was sich nicht messen lässt.
Steffensky wünscht sich eine Kirche, die in einer Welt des Funktionierens für die „nutzlosen Schönheiten“ eintritt. Ich würde ergänzen: Das gilt auch für Kliniken. Gerade dort, wo alles durch Diagnosen, Pläne und Kostenstrukturen geregelt ist, braucht es Räume, in denen Menschen einfach singen dürfen – ohne Zweck, ohne Leistungsdruck, ohne Optimierungsversprechen.
Was bleibt
Ich glaube nicht, dass das Singen am Mittwochabend jemanden „heilt“. Ich weiß nicht, ob es die Depression vertreibt, die Angst lindert, den Schmerz weniger macht.
Aber ich weiß: Es öffnet Raum. Für einen Moment. Für einen Abend. Für dreißig Menschen, die sonst mit ihrer eigenen Enge allein wären. Und das ist nicht wenig. Das ist Gnade.
Für mich als Seelsorger ist das der Kern von Kirche: Einstimmen in einen Gesang, der größer ist als wir – und doch jeden einzelnen Ton braucht. Auch den brüchigen. Auch den leisen.
Matthias Schmidt
Klinikseelsorger
Januar 2026
Quellen
¹ Fulbert Steffensky: „Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte – Über die Schönheit des Protestantismus“. Vortrag beim Kirchentag, Kassel, 26. September 2009. Online verfügbar: https://www.ekd.de/090926_steffensky_schoenheit_protestantismus.htm
² Fulbert Steffensky: „Mit Lob und Dank gegen Verbissenheit und Zwang – die bösen Geschwister des Glaubens“. In: chrismon. Online verfügbar: https://chrismon.de/das-wort/mit-lob-und-dank-gegen-verbissenheit-und-zwang-die-bosen-geschwister-des-glaubens-2754